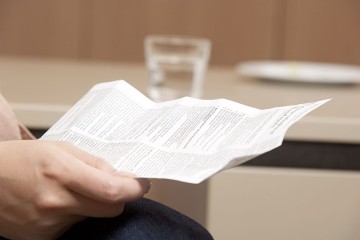An die Veröffentlichung des Nutzenbewertungsbeschlusses schließt sich eine sechsmonatige Phase der Preisbildung an, es sei denn der G-BA ordnet das Arzneimittel einer Festbetragsgruppe zu. In regelhaft vier Verhandlungsterminen innerhalb von sechs Monaten sollen der GKV-Spitzenverband (GKV-SV) und der pharmazeutische Unternehmer für das Arzneimittel den in Deutschland geltenden Abgabepreis für das Arzneimittel, den sog. „Erstattungsbetrag“ (§ 130b SGB V), verhandeln.
Auf Grundlage des Beschlusses des G-BA zum Zusatznutzen des neuen Arzneimittels werden Verhandlungen zwischen dem pharmazeutischen Unternehmer und dem GKV-SV zur Vereinbarung eines Erstattungsbetrages geführt. Der Erstattungsbetrag gilt ab dem 7. Monat nach dem erstmaligen Inverkehrbringen des Arzneimittels als neuer bundesweit gültiger und einheitlicher Abgabepreis für gesetzlich Versicherte wie auch Privatversicherte und Selbstzahler. Daher sind als weitere Teilnehmer an den Verhandlungen Vertreter des Verbandes der privaten Krankenversicherung vorgesehen. An den Verhandlungen nimmt auch ein Vertreter einer Krankenkasse teil, um praktische Erfahrungen zu Versorgungsaspekten einzubringen. Der Erstattungsbetrag ist durch die Unternehmen an Preis– und Produktverzeichnisse für Arzneimittel zu melden. Dort ist er für Marktteilnehmer zur Orientierung einsehbar; für Krankenhäuser gilt er qua Gesetz im Einkauf als Höchstpreis.
Die jeweiligen Verhandlungsvorgaben ergeben sich einerseits aus dem Gesetz, vor allem § 130b SGB V, sowie andererseits aus der zwischen dem GKV-SV und den für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen maßgeblichen Spitzenorganisationen der pharmazeutischen Unternehmer auf Bundesebene getroffenen Rahmenvereinbarung nach §130b Absatz 9 SGB V.
In den Jahren seit Bestehen des AMNOG wurden die Preisbildungsvorgaben nahezu jedes Jahr geändert. Zentrale Vorgaben zur Verhandlung des Erstattungsbetrages richten sich nach dem Ergebnis der Nutzenbewertung durch den G-BA und - seit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz (GKV-FinStG) – zusätzlich auch danach, ob eine patentgeschützte oder eine generische zweckmäßige Vergleichstherapie bestimmt wurde.
Überblick Preisbildungsvorgaben
Ein Grundsatz des AMNOG ist die Preisdifferenzierung nach nachgewiesenem Zusatznutzen. Dieser war und ist allerdings nicht in Reinform gegeben, andere Kriterien treten hinzu.
Zunächst können folgende nach Zusatznutzen und Bestand oder Wegfall der von Unterlagen- und Patentschutz der zweckmäßigen Vergleichstherapie differenzierende Vorgaben als Ausgangspunkt der Verhandlungen angesehen werden:
- Für Arzneimittel, für die der G-BA keinen Zusatznutzen festgestellt hat und deren zweckmäßige Vergleichstherapie keinen Patentschutz und Unterlagenschutz besitzen, soll ein Erstattungsbetrag vereinbart werden, der nicht zu höheren Jahrestherapiekosten führt als die vom G-BA bestimmte wirtschaftlichste zweckmäßigen Vergleichstherapie ohne Patentschutz.
- Für Arzneimittel, für die der G-BA keinen Zusatznutzen festgestellt hat und deren durch den Gemeinsamen Bundesausschuss bestimmte zweckmäßige Vergleichstherapie einen Wirkstoff bestimmt, für den Patentschutz oder Unterlagenschutz besteht, ist ein Erstattungsbetrag zu vereinbaren, der zu Jahrestherapiekosten führt, die mindestens 10 Prozent unterhalb derjenigen der zweckmäßigen Vergleichstherapie liegen (Teil der sog. Leitplanken).
- Für ein Arzneimittel, für das ein Zusatznutzen nach § 35a Absatz 1 Satz 5 als nicht belegt gilt, da kein vollständiges Dossier vorgelegt wurde, ist ein Erstattungsbetrag zu vereinbaren, der zu in angemessenem Umfang geringeren Jahrestherapiekosten führt als die durch den Gemeinsamen Bundesausschuss bestimmte zweckmäßige Vergleichstherapie; die Vorgabe eines mindestens 10 prozentigen Abschlages gilt für diese Fallgruppe entsprechend.
Bei Arzneimitteln mit Zusatznutzen ist bei den Vorgaben zunächst nach dem Bestand oder Wegfall von Unterlagen- und Patentschutz und dann nach der Wahrscheinlichkeit und dem Ausmaß des Zusatznutzens und der zweckmäßigen Vergleichstherapie zu differenzieren:
- Wurde eine zweckmäßige Vergleichstherapie bestimmt, für die weder Patent- noch Unterlagenschutz besteht, wird gemäß Rahmenvereinbarung der Erstattungsbetrag für Arzneimittel mit Zusatznutzen durch einen Zuschlag auf die Jahrestherapiekosten der zweckmäßigen Vergleichstherapie vereinbart.
- Bei Arzneimitteln, für die eine zweckmäßige Vergleichstherapie bestimmt wurde, für die noch Patent- und Unterlagenschutz besteht, gelten je nach Ausmaß des Zusatznutzens bei der Preisfindung unterschiedliche Vorgaben nach § 130b Abs. 3 SGB V :
- Für Arzneimittel mit beträchtlichem oder erheblichem Zusatznutzen findet die Rahmenvorgabe eines Zuschlags auf die Kosten der zweckmäßigen Vergleichstherapie sowie das gesetzliche Kriterium der Jahrestherapiekosten vergleichbarer Arzneimittel Anwendung.
- Für Arzneimittel mit geringem oder nicht quantifizierbarem Zusatznutzen gilt, dass der Erstattungsbetrag nicht zu höheren Kosten führt als die wirtschaftlichste zweckmäßige Vergleichstherapie (Teil der sog. Leitplanken).
Hat der G-BA mehrere gleichermaßen zweckmäßige Vergleichstherapien mit und ohne Patent – und Unterlagenschutz bestimmt, richtet sich die einschlägige Preisfindungsvorgabe nach der wirtschaftlichsten Alternative. Daneben gibt es bestimmte Fallkonstellationen, in denen weitere Abschläge auf die Kosten der zweckmäßigen Vergleichstherapie oder auf den zuvor vereinbarten Erstattungsbetrag zu vereinbaren sind
Das Medizinforschungsgesetz (MFG) hat die Vorgaben zur Preisfindung bei Arzneimitteln mit nicht nachgewiesenem, geringem oder nicht quantifizierbarem Zusatznutzen, für die eine zweckmäßige Vergleichstherapie bestimmt wurde, für die noch Patent- und Unterlagenschutz besteht (so. Leitplanken), gelockert.
Die Vorgaben der Preisobergrenze der Jahrestherapiekosten oder eines Abschlages von mindestens 10 Prozent unter den Kosten der zweckmäßigen Vergleichstherapie („Leitplanken“), finden keine Anwendung für diese, wenn der pharmazeutische Unternehmer dem Gemeinsamen Bundesausschuss darlegt, dass er klinische Studien zu einem Anteil von mindestens 5 Prozent in Deutschland durchgeführt hat. Der G-BA überprüft im Rahmen der Nutzenbewertung, ob diese Voraussetzung erfüllt ist. Ist dies der Fall, kann der pharmazeutische Unternehmer den Erstattungsbetrag ohne Berücksichtigung der „Leitplanke“ aushandeln.
Zudem sollen laut Gesetz die Jahrestherapiekosten vergleichbarer Arzneimittel zusätzlich berücksichtigt werden, welche das Marktumfeld für das neue Arzneimittel repräsentieren.
Das Kriterium der tatsächlichen Abgabepreise in anderen europäischen Ländern gewichtet nach den jeweiligen Umsätzen und Kaufkraftparitäten findet seit 1. Januar 2025 keine Anwendung mehr.
Für Arzneimittel, die in unterschiedlichen Patientengruppen jeweils einen unterschiedlichen Zusatznutzen aufweisen, ist aufgrund höchstrichterlicher Rechtsprechung geklärt, dass ein sog. „Mischpreis“ zulässig ist (BSG, Urteil vom 04.07.2018, B 3 KR 21/17 R). Dafür werden zunächst die oben beschriebenen Preisfindungsvorgaben auf die einzelnen Patientengruppen angewendet: Je nach Zusatznutzen sowie Patent- und Unterlagenstatus der jeweils bestimmten zweckmäßigen Vergleichstherapie wird ein Teilbetrag angesetzt. Die Teilbeträge werden dann über eine Gewichtung anhand der jeweiligen Patientengruppengröße zu einem einheitlichen Erstattungsbetrag als Mischkalkulation zusammengeführt.
Das Medizinforschungsgesetz (MFG) aus dem Jahr 2024 änderte jüngst die bisherige Regelung zur Preisgestaltung von Arzneimitteln, die erstmalig in den Markt eingeführt werden, fundamental: Bei Wirkstoffen, die nach dem 1. Januar 2025 nach Inverkehrbringen erstmalig in Verhandlung sind, besteht für pharmazeutische Unternehmer nun die Möglichkeit, den Erstattungsbetrag gemäß § 130b Abs. 1c SGB V (neu) nicht an öffentliche Preis– und Produktverzeichnisse zu melden. Hierzu ist ein entsprechender Nachweis gegenüber dem GKV-Spitzenverband zu erbringen, dass eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Deutschland vorhanden ist, relevante eigene Projekte verfolgt werden und Kooperationen mit öffentlichen Einrichtungen in Deutschland bestehen.
Weitere Inhalte einer Regelung nach §130b SGB V
Neben dem Erstattungsbetrag sollen Vereinbarungen u. a. auch Voraussetzungen für eine indikationsgerechte, zweckmäßige und wirtschaftliche Verordnungsweise des jeweiligen Arzneimittels festlegen – auch im Kontext der Vereinbarung von Praxisbesonderheiten. Mengenbezogene Staffelung oder ein jährliches Gesamtmengen– oder Gesamtausgabenvolumen sind seit dem GKV-FinStG 2022 Pflichtinhalte, zugleich aber auch der Gestaltungsfreiheit der Vertragsparteien zugänglich. Die Vereinbarungen haben eine gesetzliche Mindestlaufzeit von einem Jahr; gesetzliche Sonderkündigungsrechte, beispielsweise aufgrund eines neuen Nutzenbewertungsbeschlusses, ermöglichen eine vorzeitige Lösung von der Vereinbarung.